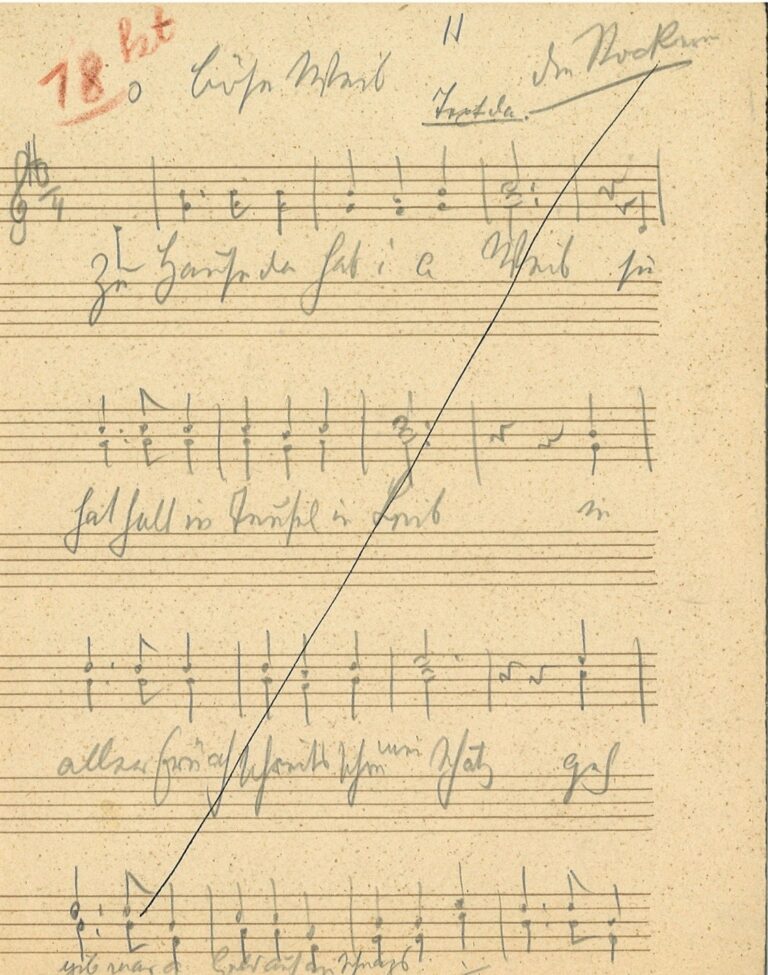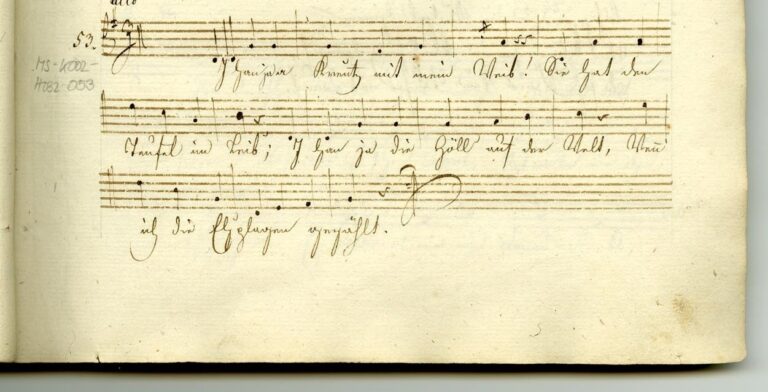Volkskultur Steiermark GmbH
Sporgasse 23, 8010 Graz
Tel. +43 / 316 / 90 85 35
office@volkskultur-steiermark.at
www.volkskultur-steiermark.at
www.steirisches-heimatwerk.at
Öffnungszeiten:
Mo bis Do: 9.00 – 16.00 Uhr
Fr: 9.00 – 13.00 Uhr
Volkskultur Steiermark GmbH
Sporgasse 23, 8010 Graz
Tel. +43 / 316 / 90 85 35
office@volkskultur-steiermark.at
www.volkskultur-steiermark.at
www.steirisches-heimatwerk.at
Öffnungszeiten:
Mo bis Do: 9.00 – 16.00 Uhr
Fr: 9.00 – 13.00 Uhr